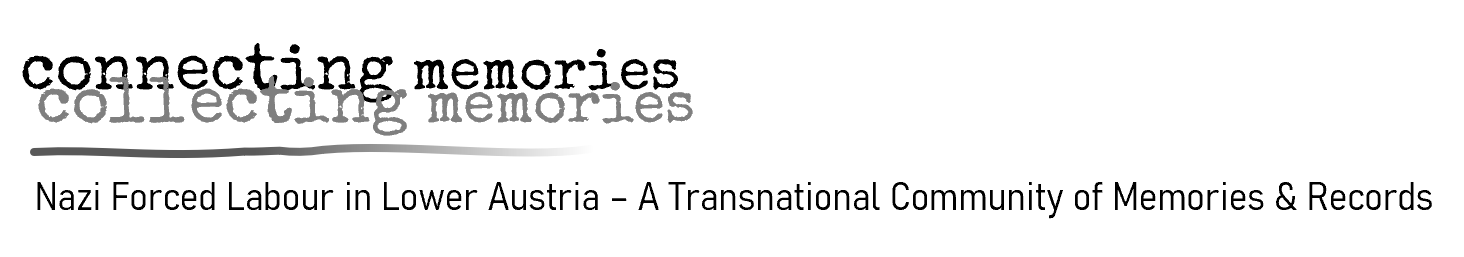Forschungsprojekt: „Erforschen – Bewahren – Teilen. Eine transnationale Community-Plattform zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit in Niederösterreich“
Während des Zweiten Weltkrieges wurden in fast allen Städten und Dörfern des Deutschen Reiches ausländische Zivilpersonen und Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit eingesetzt. Obwohl die NS-Zwangsarbeit seit vielen Jahren erforscht wird, sind zahlreiche Aspekte – etwa ihre regionalen Ausprägungen, die sozialen Beziehungen zur heimischen Zivilbevölkerung oder individuelle Schicksale – noch wenig bekannt. Dies gilt auch für Niederösterreich, wo die Geschichte der NS-Zwangsarbeit trotz wichtiger Grundlagenarbeiten bis heute nicht ausreichend erforscht und dokumentiert ist.
Sowohl Nachkommen ehemaliger Zwangsarbeiter:innen als auch Bewohner:innen jener Orte, an denen Zwangsarbeit stattfand, bewahren jedoch noch private Dokumente, Fotos und andere Erinnerungsobjekte auf. Diese Materialien bieten wertvolle Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Zwangsarbeiter:innen während der NS-Zeit. Ebenso werden in vielen Familien bis heute Erinnerungen und Erzählungen weitergegeben.
Ziel der digitalen Plattform „Connecting Memories“ ist es, digitalisierte Materialien aus privater Hand zu sammeln, zu bewahren und für die Forschung zugänglich zu machen. Sie soll den Austausch zwischen Nachkommen, lokalen Initiativen, Wissenschaftler:innen und Expert:innen fördern und gemeinsame Sammlung sowie Forschung ermöglichen.
Gemeinsam mit interessierten Citizen Scientists und Descendant Scientists werden im Projekt digitale Werkzeuge zur Archivierung, Wissensgenerierung und Forschung erprobt. Dabei entstehen neue Formen der Recherche, Zusammenarbeit, Datenvernetzung und Kommunikation. Als Fallbeispiele dienen die ungarisch-jüdische Zwangsarbeit in Niederösterreich sowie das Kriegsgefangenenlager Stalag XVII B in Krems-Gneixendorf.
Die Beteiligung von Nachkommen und Interessierten am Thema Zwangsarbeit erfordert einen besonders reflexiven Zugang, da es sich um eine gewaltvolle Vergangenheit mit unterschiedlichen Erinnerungsgemeinschaften handelt. Das Projekt untersucht daher auch, welche Formen der Beteiligung und Auseinandersetzung im Umgang mit dieser komplexen Geschichte ein dialogisches Erinnern und Forschen fördern können.
Laufzeit: 2025-2027
Fördergeber: GFF Niederösterreich (Citizen Science) Projekt-ID: FTI24-C-020
Lead Partner:
Universität für Weiterbildung Krems, Department für Kunst- & Kulturwissenschaften
Leitung: Edith Blaschitz, Eva Mayr
Projektmitarbeiter:innen: Carl Philipp Hoffmann, Karin Böhm
Forschungspartner:
Institut für Jüdische Geschichte Österreichs (Leitung: Martha Keil): Merle Bieber
Wiener Institut für Holocauststudien (Leitung: Éva Kovacs): Kinga Frojimovics
Kooperierende Archive:
Stadtarchiv Krems
Stadtarchiv St. Pölten
Scientific Advisory Board:
Thomas Cauvin (Centre for Digital History at the University of Luxembourg)
Stefan Eminger (Niederösterreichisches Landesarchiv)
Dirk Luyten (Study- and Documentation Centre for War and Contemporary Society of the Belgian State Archives)
Barbara Stelzl-Marx (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung)
Olga Ungar (The World Holocaust Remembrance Center Yad Vashem).